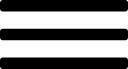Nr. 13: Schicksale aus der Zeit der letzten Immobilienkrise
In der lange anhaltenden Tiefzinsphase mit Libor-Zinssätzen von teils unter einem Prozent mag man sich ungern an den Anfang der 90er Jahre zurückerinnern. Damals stiegen die Hypothekarzinssätze auf über 8%, nachdem die Liegenschaftsbesitzer jahrzehntelang mit einer Bandbreite von 4 bis 6% rechnen konnten. Persönlich glaube ich in einer Epoche niedriger Inflation nicht an eine rasch drohende Wiederholung solcher Verwerfungen. Weshalb? Weil man sich meines Erachtens auf die Auftürmung weiterer Schuldenberge durch die meisten Staaten verlassen kann, und diese zwingen zur künstlichen Tiefhaltung der Kreditzinsen.
Seit einem Jahrzehnt profitiere ich vom tiefen Liborsatz. Auch als er kurz einmal auf 4% stieg, blieb ich dabei. Damals verlor ein Freund, der sein Eigenheim ebenfalls auf Liborbasis finanziert hatte, die Nerven und wechselte auf eine Festhypothek von 3,6%. Bei einer Schuld von 600‘000 Franken sind dies jährlich über 20‘000 statt 6‘000 Franken.
Vor gut 20 Jahren erwischte die geplatzte Immobilienblase einen uns bekannten, bereits älteren Arzt auf dem falschen Fuss. Er besass zusammen mit seiner Frau an der Zürcher Goldküste ein Einfamilienhaus, das seine Bank im Aufschwung Ende der 80er Jahre auf zwei Millionen geschätzt hatte. Und dann trat ein, was mehr Armut schafft als niedrige Löhne oder Arbeitslosigkeit: eine Scheidung. Seiner Frau wurde die Hälfte des gemeinsamen Vermögens, eine Million in Wertschriften und Bargeld, zugesprochen. Er selbst behielt die zur Hälfte mit Hypotheken belastete Immobilie, in der sich seine Hausarztpraxis befand. Auf dem Papier verblieb ihm ebenfalls eine Million – bis die Bank in der Immobilienkrise sein Haus noch mit einer Million bewertete. Es war nun also zu 100% mit Hypotheken belastet, und man forderte ihn auf, die üblichen 20% - 200‘000 nicht vorhandene Franken – nachzuschiessen. Eine Privatperson rettete ihn und seine Praxis als Existenzgrundlage.
Ein noch schlimmeres Schicksal traf meinen Verlagsvertreter. Er hatte in Maisprach ein Einfamilienhaus für 3‘000 Franken im Monat gemietet und hielt Ausschau nach einem Kaufobjekt. Ein Haus im Zentrum des Landes hätte ihm seine häufigen Reisen bis ins Bündnerland und Tessin erleichtert, aber er war nun einmal Baselbieter. Und das begehrte Objekt schien ihm gerade der Immobilienkrise wegen verführerisch zu winken: ein Haus im Rohbau, das seinen Käufer ab Plan in den Konkurs getrieben hatte, zuoberst am Rebhang, an den er aus der Ebene so sehnsüchtig empor geblickt hatte.
Die 900‘000 Franken erschienen mir als ein gar stolzer Preis - und dann setzte sich der Fluch auf dieser Liegenschaft fort. Am Ende kostete sie 1,25 Millionen, die Prozesskosten mit dem Generalunternehmer nicht mitgerechnet. Bei einem Besuch waren meine Frau und ich frappiert ob des Gefühls der Enge in allen Räumen, der grösste weniger als 30 Quadratmeter, die separate Küche mit immerhin einem Tischchen für zwei Personen und dem Minibad. Der Weg von der Gemeinschafts-Tiefgarage aussen herum war steil und lang, für Personen nahe am Rentenalter wenig empfehlenswert. Die anhaltende finanzielle Bedrängnis überschattete den kurzen Lebensabend dieses Freundes.
Auf den 45-Milliarden-Verlust aus dem Hypothekargeschäft reagierten die damals drei Grossbanken, indem sie die Kreditvergabe von den lokalen Filialen in die Zentrale verlegten. Dies wurde nicht nur meinem Verlagsvertreter zum zusätzlichen Verhängnis, sondern ähnlich auch dem Zeitungsmacher und Mehrfamilienhausbesitzer, dessen Biografie ich verfasst habe: Seine Winterthurer Kreditbank wurde von den „Winterthur Versicherungen“ übernommen. Deren Kreditchef war ausgerechnet jener Lokalpolitiker, dessen Umzug in eine andere Gemeinde in der Zeitung gemeldet worden war und ihn das Amt kostete. Er „rächte“ sich mittels Kündigung einer Hypothek, was den Zeitungsmacher infolge Zwangsverkaufs mehr als eine Million kostete.