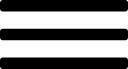Nr. 10: "Der Zinssatz drückt das Risiko aus" gilt nicht mehr
Es gehört längst zum ökonomischen Allgemeinwissen, dass die Höhe der Kreditzinssätze mit dem Risiko korreliert. Und schon trifft diese Weisheit nicht mehr zu. Seit vielen Jahren einer verhängnisvollen Tiefzinspolitik, eine der Ursachen der Immobilien- und Finanzkrise, scheint die Sonne über den Schuldnern. Je tiefer die meisten Staaten im Schuldensumpf versinken, desto grösser muss ihr Interesse an weiterhin niedrigen Zinsen sein. Diese drücken das Pleiterisiko in keiner Weise mehr aus. Die Dummen in diesem üblen Spiel sind einmal mehr die Sparer. In früheren Jahren wurden sie durch massive Inflationsraten enteignet und zahlten erst noch Einkommenssteuern auf die entwerteten Zinserträge sowie Vermögenssteuern. Dies ist der schnellste Weg, um aus kleinen Vermögen noch kleinere zu machen.
Unter die glücklichen Schuldner reihen sich auch die Hauseigentümer, solange sie die Hypothekarzinsen und allfällige Amortisationszahlungen leisten können. Alle Vierteljahre blicke ich genüsslich auf den unveränderten Liborsatz von rund einem Prozent. Wie anders war das doch im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, als die Hypozinsen zwischen 4 und 6% schwankten! Es gab Zeiten, in denen unsere Zinslast 20‘000 Franken betrug, um 1990 kurz einmal gar über 30‘000 Franken mit einem horrenden Zinssatz von 10,5% auf der Liegenschaft in Frankreich. Nicht auszudenken, was heute ein rascher Anstieg der Hypozinsen auf 3 oder 4% für Neukäufer bedeuten würde, die gerade mit Ach und Krach ihre Mindestanzahlung zusammengeklaubt haben.
Nach meiner Überzeugung reicht das Geldverständnis der meisten Menschen nur bis zu einer Million. Tausend Tausendernoten kann man sich noch vorstellen. „Millionär“ sein ist selbst für wohlhabende Schweizer meist ein fernes Ziel. Vor 80 Jahren konnte ein Millionär selbst bei nur 2% Zinsertrag, also 20‘000 Franken, sehr komfortabel leben. Facharbeiter verdienten damals um die 4‘000 Franken im Jahr. Heute muss jemand fünf Millionen auf die Waage bringen, um mit mündelsicheren Anlagen auch nur auf einen Jahresertrag von 50‘000 Franken zu kommen. Davon frisst dann allein die Vermögenssteuer die Hälfte weg.
Aber Reiche rechnen im Allgemeinen anders. Beinahe naturgesetzlich werden sie immer reicher. Wenn der Kleinanleger mit 10‘000 Franken an die Börse geht, lohnt sich ein Aktienverkauf erst bei 10% Gewinn. Dem mittleren Anleger mit 100‘000 Franken genügt bereits ein Gewinn von 1%, um denselben Ertrag von 1000 Franken zu realisieren, die Courtagen einmal beiseite gelassen. Wer mit einer Million das Börsenparkett betritt, benötigt sogar nur ein Promille Gewinn. Aus 100‘000 Franken werden bei einem Plus von 10% 110‘000 Franken, aus einer Million jedoch 1‘100‘000 Franken, also 90‘000 Franken mehr. Die Schere der Vermögensbildung öffnet sich – übrigens auch im negativen Fall: Anhaltende Verluste zerstören kleine Vermögen schon deswegen rascher, weil deren Besitzer zu wenig abgebrüht sind, bei fallenden Kursen zeitig auszusteigen. Erfahrungsgemäss verlieren Kleinanleger ihr Kapital genau aufgrund dieser Schwäche. Ausserdem sind die meisten Multimillionäre Besitzer von Mietliegenschaften, die einen höheren Ertrag bringen als Obligationen und Festgelder.
Erstaunlich ist, dass nicht einmal krasse Steuerprogressionssätze den Anstieg der Vermögen von Reichen merklich einschränken. Eine Erklärung bietet das Phänomen der Vermögenspreisinflation, das bei Kunsthandels-Auktionen und Immobilienverkäufen an Top-Lagen sichtbar wird.